Digitale Gesundheitsanwendungen im Aufwind: Was der DiGA-Report 2024 verrät
Vier Jahre nach der Einführung digitaler Gesundheitsanwendungen (DiGA) zeigt der aktuelle DiGA-Report 2024: Die Erfolgsgeschichte geht weiter – und bleibt dennoch herausfordernd. Der Report des Spitzenverbands Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) zieht eine umfassende Bilanz zur Marktentwicklung von DiGA zwischen Oktober 2020 und Dezember 2024. Er basiert auf einer breiten Datenbasis der Hersteller und bietet detaillierte Einblicke in Verordnungszahlen, Nutzungstrends, regulatorische Rahmenbedingungen sowie politische Weichenstellungen.
Über 870.000 eingelöste Freischaltcodes belegen eindrucksvoll, wie sehr sich DiGA in der Regelversorgung etabliert haben. Das Angebot ist dabei nicht nur gewachsen, sondern auch vielfältiger geworden: Digitale Anwendungen unterstützen heute die Behandlung von Depressionen, chronischen Schmerzen, Stoffwechselerkrankungen, Angststörungen und vielem mehr.
Längst sind DiGA kein Nischenphänomen mehr, sondern entwickeln sich zum dritten Versorgungssektor – neben ambulanter und stationärer Versorgung. Sie bieten orts- und zeitunabhängige Therapieoptionen, stärken die Souveränität der Patient:innen und entlasten gleichzeitig ein überlastetes Gesundheitssystem – sei es durch verkürzte Wartezeiten, effizientere Abläufe oder datenbasierte Therapieentscheidungen.
Gleichzeitig zeigt der Report auch die Herausforderungen: Langwierige Freischaltprozesse, ausstehende technische Umsetzungen wie das E-Rezept und zunehmende bürokratische Anforderungen bremsen das volle Potenzial der digitalen Anwendungen aus. Der SVDGV fordert deshalb eine entschlossene Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen – nicht zuletzt, um Deutschlands Vorreiterrolle im Bereich digitaler Gesundheitsversorgung zu sichern.
Neuer Schwung durch das Digital-Gesetz
Mit dem Digital-Gesetz, das im März 2024 in Kraft trat, wurde die rechtliche Grundlage für digitale Gesundheitsanwendungen weiterentwickelt – mit dem Ziel, den Zugang zu erleichtern und die Versorgung zu verbessern. Eine zentrale Neuerung: Krankenkassen sind seitdem verpflichtet, Freischaltcodes für DiGA innerhalb von zwei Arbeitstagen bereitzustellen. In der Theorie ein echter Fortschritt – in der Praxis bleibt die Umsetzung jedoch hinter den Erwartungen zurück. Der Report zeigt: Im Schnitt dauert es immer noch rund 14 Tage, bis Patient:innen ihre DiGA nutzen können.
Ein echter Meilenstein wäre die Einführung des E-Rezepts für DiGA, das ab 2025 verpflichtend werden soll. Die Vision: Patient:innen sollen ihre DiGA direkt und ohne Umweg über ihre Krankenkasse einlösen können – vergleichbar mit Arzneimitteln. Doch bislang ist dieser Prozess noch Zukunftsmusik. Der SVDGV fordert daher eine konsequente Digitalisierung und Automatisierung der Verordnungsprozesse.
Zukunftsweisend ist auch der Einstieg in das Konzept der Value-Based Healthcare: Erstmals wird ein Teil der DiGA-Vergütung ab 2026 an den tatsächlichen Behandlungserfolg gekoppelt – gemessen über die sogenannte anwendungsbegleitende Erfolgsmessung (AbEM). Eine prinzipiell begrüßenswerte Idee, die jedoch aktuell durch hohe bürokratische Anforderungen und methodische Unschärfen konterkariert wird. Der Report macht deutlich: Ohne praxistaugliche Umsetzung droht ein Rückschritt statt eines Fortschritts.
Ein Markt wächst – und reift
Trotz aller Herausforderungen ist der DiGA-Markt weiter auf Wachstumskurs. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 waren 59 digitale Gesundheitsanwendungen im offiziellen BfArM-Verzeichnis gelistet – ein Wachstum von 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Besonders erfreulich: Zwei Drittel dieser DiGA sind mittlerweile dauerhaft aufgenommen – ein Zeichen für hohe Qualität und nachhaltigen Nutzen.
Auch die thematische Breite hat deutlich zugenommen. DiGA sind heute für verschiedenste Indikationen verfügbar – von psychischer Gesundheit über chronische Schmerzen und Stoffwechselerkrankungen bis hin zu Herz-Kreislauf- und Krebsindikationen.
Bemerkenswert ist außerdem: Die Nutzerinnen und Nutzer kommen aus allen Altersgruppen. Zwar liegt der Anteil der weiblichen Nutzenden bei rund 75 %, doch auch Menschen über 50 nutzen DiGA zunehmend. Die Annahme, digitale Therapien seien nur etwas für Digital Natives, wird damit klar widerlegt.
DiGA goes Europe
Der DiGA-Report 2024 dokumentiert eindrucksvoll, dass das deutsche Modell digitaler Gesundheitsanwendungen inzwischen auch international als Vorbild dient. Vor allem das DiGA-Fast-Track-Verfahren, das einen schnellen Zugang zur Regelversorgung ermöglicht, stößt auf großes Interesse im europäischen Ausland. So haben unter anderem Frankreich und Belgien vergleichbare Systeme zur Erstattung digitaler Therapien etabliert – nach deutschem Vorbild.
Gleichzeitig zeigt der Report: Der Erfolg der DiGA in Europa hängt von mehr ab als von nationalen Einzelinitiativen. Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung (SVDGV) fordert daher eine europaweite Harmonisierung der regulatorischen Rahmenbedingungen, insbesondere im Hinblick auf Zulassung, Evidenznachweise und Erstattung digitaler Medizinprodukte. Deutschland könnte mit seiner Vorreiterrolle wertvolle Impulse für ein einheitliches europäisches Vorgehen liefern.
Blick nach vorn: Was jetzt zu tun ist
Im abschließenden Kapitel benennt der DiGA-Report 2024 klare Handlungsempfehlungen für die nächste Legislaturperiode. Der SVDGV sieht dringenden Handlungsbedarf, um das volle Potenzial digitaler Gesundheitsanwendungen auszuschöpfen.
Zentrale Forderungen sind:
- Bürokratische Hürden abbauen, etwa durch die Abschaffung der analogen Freischaltprozesse zugunsten eines direkten digitalen Zugangs über E-Rezepte.
- Bekanntheit und Akzeptanz von DiGA bei Patient:innen und Behandler:innen gezielt stärken – unter anderem durch Aufklärungskampagnen und Integration in die Aus- und Weiterbildung von Ärzt:innen, Psychotherapeut:innen und Gesundheitsfachberufen.
- DiGA nicht isoliert betrachten, sondern als Bestandteil einer datenbasierten, hybriden Versorgung weiterentwickeln – etwa in Kombination mit elektronischer Patientenakte (ePA), Telemedizin oder Disease Management Programmen (DMP).
Diese Empfehlungen verstehen sich laut Report nicht als bloße Wunschliste, sondern als konkrete politische Agenda, um DiGA als festen und wirksamen Bestandteil der Gesundheitsversorgung bis 2030 zu etablieren.
Fazit
Digitale Gesundheitsanwendungen sind längst mehr als ein digitales Experiment – sie sind eine Erfolgsgeschichte „Made in Germany“. Mit nahezu einer Million Verordnungen haben DiGA gezeigt, dass sie Versorgungslücken schließen, Patient:innen empowern und das Gesundheitssystem entlasten können. Doch wie der DiGA-Report 2024 deutlich macht, braucht es jetzt den richtigen politischen und regulatorischen Rückenwind, um diesen Erfolg nachhaltig zu sichern.
Der Report liefert fundierte Zahlen, wertvolle Einordnungen und konkrete Empfehlungen für die Zukunft. Wer sich vertiefend mit der Entwicklung, den Herausforderungen und Perspektiven des DiGA-Markts befassen möchte, kann den vollständigen Report hier kostenlos herunterladen:
Artikel
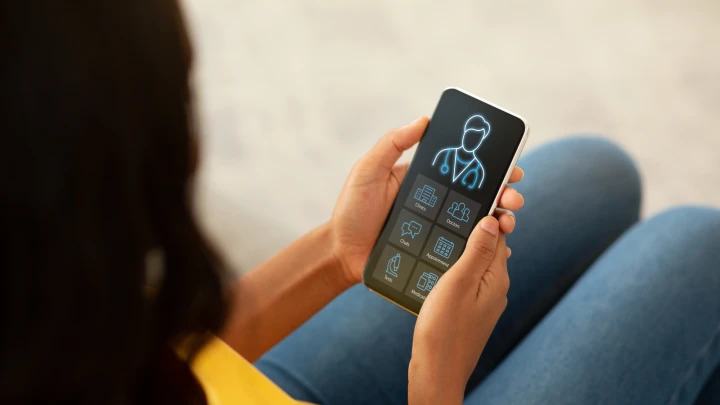
DiGAs und ihr Potenzial für das moderne Gesundheitswesen
Der Weg einer DiGA: Von der Entwicklung bis zur Implementierung. Jetzt Beitrag lesen

Digitale Arztpraxis: Wie moderne Software Ihre Praxisabläufe optimiert
Entdecken Sie, wie cloudbasierte Systeme Abläufe vereinfachen und mehr Zeit für Patienten schaffen – jetzt den Schritt zur digitalen Arztpraxis wagen!